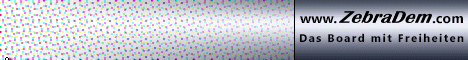[FONT="Arial Black"]Am Dienstag kommt Windows Vista von Microsoft in die Läden. Das Betriebssystem bringt einen digitalen Urheberschutz, der den Personalcomputer zukünftig den Wünschen der amerikanischen Filmstudios unterstellt.[/FONT]
Die Geschichte des Personalcomputers beginnt im August 1981 mit der Vorstellung des ersten PC von IBM und sie endet am kommenden Dienstag. Dann kommt Microsofts neues Betriebssystem Windows Vista in die Läden. Kritiker von Microsoft behaupten, dass damit die Ära des PC als offener Computerplattform jeder kann Programme schreiben und Zusatzgeräte entwickeln zu Ende geht.
Schuld daran ist der in Vista integrierte digitale Urheberschutz, der hochaufgelöste Videos vor Hackern schützen soll. Dieses Digital Rights Management (DRM) behindere die freie Entwicklung von Soft- und Hardware für Vista-Rechner, kritisiert etwa Peter Gutmann von der Universität Auckland in Neuseeland. «Der digitale Urheberschutz verschlechtert ausserdem Rechenleistung und Stabilität der Computer und erhöht die Hard- und Softwarekosten», sagt der Computerwissenschafter.
[FONT="Arial Black"]Innere Werte[/FONT]
Die Kritik des Wissenschafters fällt nicht in die Rubrik der üblichen Microsoft-Beschimpfungen. Gutmann beruft sich bei seiner Analyse auf die vom Softwarekonzern publizierten Spezifikationen des neuen Betriebssystems.
Auf den ersten Blick ist die von Gutmann befürchtete Revolution gar nicht zu erkennen: Wie immer, wenn Microsoft ein neues Produkt lanciert, gibt es neue Funktionen, die die Bedienung des PC komfortabler machen. Der Schutz vor Viren und Angriffen aus dem Internet soll sich verbessern. Und natürlich gibt es auch ein optisches Facelifting. Dass die äussere Schönheit angemessene innere Werte voraussetzt, ist ebenfalls eine der Konstanten, die bisher noch jedes neue Betriebssystem begleitet haben. Vista verlangt nach einer Prozessorgeschwindigkeit von mindestens 1 Gigahertz, einem Arbeitsspeicher von 1 Gigabyte und nach 40 Gigabyte freiem Platz auf der Festplatte. Das sind zwar nur nackte Zahlen. Aber in den Ohren der Hardwarehersteller, die sich auf kommende Umsätze freuen, klingen sie wie Musik.
Insofern unterscheidet sich der Start von Vista nicht von dem seiner Vorgängerversionen seit 1985. Es ist das gleiche Rezept, das Microsoft zum grössten Softwarekonzern der Welt gemacht hat, zu einem Quasi-Monopolisten auf dem Markt der Betriebssysteme.
Obwohl Microsoft bisweilen mit umstrittenen Methoden versucht, Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, kann jedermann Soft- und Hardware für Windows-Computer entwickeln und verkaufen der PC war bisher ein mehr oder weniger offenes System.
«Dieses Prinzip gilt zwar theoretisch auch in Zukunft. Aber faktisch gehört es ab Dienstag der Vergangenheit an», sagt Peter Gutmann. Ursache ist die von Microsoft angestrebte Fähigkeit, die Wiedergabe von hochaufgelösten Filmen auf dem PC zu ermöglichen. Der Computer rückt damit in die Nähe der Unterhaltungselektronik.
Solche als Media Center bezeichneten Geräte kann man schon heute kaufen. Doch mit dem Übergang zu den hochauflösenden DVD-Nachfolgern HD-DVD und Blu-Ray stellt sich das Problem des Kopierschutzes ganz neu. Denn beide miteinander konkurrierenden Datenträger verfügen über einen extrem ausgeklügelten digitalen Urheberschutz, der das Kopieren der Silberscheiben verhindern soll. Dieses Digital Rights Management war eine Bedingung der amerikanischen Filmindustrie: Ohne DRM keinen Jurassic Park, keinen Harry Potter und keinen Herr der Ringe im Wohnzimmer.
Blu-Ray und HD-DVD verwenden dasselbe DRM-System. Es trägt den Namen AACS (Advanced Access Content System) und wurde unter anderem von Sony, Intel, Microsoft und den grossen Hollywoodstudios Warner Brothers und Walt Disney entwickelt.
AACS ist mehr als nur ein Kopierschutz, der lediglich das Anfertigen von Duplikaten der Datenträger verhindern würde. Das System schützt den gesamten Signalweg von der DVD bis zum Monitor. Alle Datenleitungen einschliesslich des Kabels zum Bildschirm transportieren nur verschlüsselte Informationen. Selbst wenn ein Hacker auf die Idee käme, einen HD-DVD-Player aufzuschrauben, um irgendwo im Gewirr von Kabeln und Computerchips die Elektronik anzuzapfen, würde ihm das nichts nutzen.
Die Hersteller von HD-DVD- und Blu-Ray-Playern müssen die Sicherheit ihrer Produkte von den Rechte-Inhabern zertifizieren lassen. Gegen Gebühr erhalten sie für jedes als sicher eingestufte Gerät einen Schlüssel. Dabei handelt es sich um eine Art Geheimzahl, die das Entschlüsseln und damit die Wiedergabe der hochaufgelösten DVDs erlaubt.
[FONT="Arial Black"]Geheime Schlüssel[/FONT]
Die Zertifizierung eines DVD-Players kann jederzeit widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Kopierschutz von Hackern geknackt wurde. Davon betroffen sind sogar Geräte, die längst verkauft und in privaten Haushalten in Betrieb sind.
Möglich ist das, weil jede HD-DVD und Blu-Ray-Disk eine schwarze Liste (Blacklist) enthält, auf der alle ungültigen Schlüssel aufgeführt sind. Schiebt der Nutzer nun eine neue DVD mit aktualisierter Blacklist in seinen Player, wird dessen Geräte-Schlüssel annulliert. Dann lassen sich nur noch Audio- CD und alte DVD wiedergeben bei HD-Medien aber bleibt der schöne Flachbildschirm ganz einfach schwarz.
Das jedenfalls sind die technischen Möglichkeiten, die Hollywood durchgesetzt hat und die in Zukunft auch für Vista-PC gelten werden. Ob sie sich in der Realität durchsetzen lassen, ist fraglich, weil damit alle Kunden geschädigt würden, nur um eine Handvoll von Raubkopierern zu stoppen.
«Der PC als offenes System war nie dazu gedacht, ein derartiges DRM zu unterstützen», sagt Peter Gutmann. Denn hier haben weder die Hardware- Hersteller noch Microsoft als Lieferant des Betriebssystems einen Einfluss darauf, wie der Nutzer seinen PC konfiguriert, welche DVD-Laufwerke und Grafikkarten er beispielsweise verwendet. Und auch die Filmindustrie kann nur zuschauen. Oder besser: Sie konnte bisher nur zuschauen. Dank Vista sitzt Hollywood jetzt aber auf dem Regiestuhl der PC-Entwicklung.
Ab sofort muss deshalb jedes Computerteil, das hochaufgelöste Inhalte in irgendeiner Form verarbeitet, zertifiziert werden. Das gilt auch für die Programme (Treiber), die zum Lesen einer HD-Disk benötigt werden, und für jede andere Software, die am Transport des Datenstroms von der DVD bis zum Monitor beteiligt ist.
Welche Folgen diese Strategie für Vista-Kunden haben könnte, hat Gutmann in einer Arbeit («A Cost Analysis of Windows Vista Content Protection») untersucht, die er im Internet veröffentlicht hat. Gutmann schildert darin Beispiele, die sich aus der Integration von AACS in Vista ergeben. So verlangt der Schutz der Urheberrechte beispielsweise, dass analoge Grafikanschlüsse deaktiviert werden, sobald eine hochaufgelöste HD-DVD abgespielt wird. Denn analoge Signale lassen sich nicht verschlüsseln. Wer also über einen teuren Monitor mit analogen Anschlüssen verfügt, kommt nicht in den Genuss hochaufgelöster Filme, genauso wenig wie die Käufer von modernen Flachbildschirmen, die noch nicht über die verlangte Verschlüsselungstechnik verfügen.
Statt des vollständigen Abschal- tens eines Ausgangs kann Vista die Bild- oder Tonqualität auch gezielt verschlechtern. «Vista ist das einzige Betriebssystem der Welt, in dem die Fehlermeldung Bildqualität zu hoch definiert wurde», spottet Gutmann.
Hinzu kommen erhöhte Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Computers, der den immensen Datenstrom der HD-Medien in verschlüsselter Form verarbeiten muss, und spezielle Vorschriften für das Design seiner Komponenten. Beides treibt die Kosten in die Höhe genauso wie die jährlichen Lizenzgebühren für AACS.
Warum macht Microsoft so weitreichende Zugeständnisse an die Filmindustrie? Mit einem Marktanteil von 90 Prozent sollte der Konzern eigentlich am längeren Hebel sitzen.
Auch gäbe es andere Möglichkeiten, dem Urheberrecht Genüge zu tun, oh- ne das komplette Computersystem den AACS-Anforderungen zu unterwerfen. Denkbar wäre beispielsweise, die geschützten HD-Daten in unbearbeiteter Form direkt von der DVD an die Grafikkarte des PC zu schicken, statt sie im Hauptprozessor zu verarbeiten. In diesem Fall müsste nur die Grafikkarte die Einhaltung des Urheberrechts gewährleisten. Dieses für den Bildaufbau zuständige Bauteil würde sich dann gegenüber HD-Inhalten wie ein normaler HD-DVD- oder Blu-Ray-Player verhalten. Der Vorteil: Nur Computerbenutzer, die ihren Rechner für die Wiedergabe von Filmen nutzen wollen, müssten die teure Technik bezahlen.
Da sich Microsoft mit Vista aber gegen eine solche Möglichkeit entschieden hat, vermutet Gutmann, dass sich hinter der gewählten Technik eine ökonomische Strategie verbirgt. Ähnlich wie Apple einen Grossteil des Online-Musikmarktes beherrscht (vgl. nebenstehenden Artikel), könnte es das Ziel von Microsoft sein, in Zukunft den Vertrieb hochaufgelöster Kinofilme zu dominieren. Denn wenn Vista erst einmal auf 90 Prozent aller PC läuft und diese Computer mehrheitlich auch als Abspielgeräte für DVD genutzt werden, dann verfügt Microsoft über den wichtigsten Distributionskanal und kann nun seinerseits die Bedingungen bestimmen, unter denen die Inhalte verkauft werden. So gesehen, könnte sich der massive digitale Urheberschutz in Vista noch als Bumerang für Hollywood erweisen.