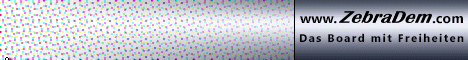[h=1]Der letzte Schrei: Mechanischer Computer[/h] Weltweit arbeiten Dutzende Forschergruppen an der Entwicklung des Quantencomputers. Wie der Rechner der Zukunft aussehen wird, ist nach wie vor unklar. Der neueste Vorschlag deutscher Physiker: ein Prozessor aus schwingenden Nanoröhrchen.
Kategorie: Physik Erstellt am 25.03.2013.
Formeln mit historischer Pointe: So könnte man die letzte Arbeit von Michael Hartmann beschreiben. Der Physiker von der TU München hat soeben mit einem ungewöhnlichen Konzept für Aufsehen in der Fachgemeinde gesorgt. Er will die Avantgarde der Computerwissenschaft in gewisser Hinsicht wieder zu ihren Ursprüngen führen, nämlich zur Mechanik.
Man erinnere sich: Anno 1938 baute Konrad Zuse den ersten programmierbaren Computer. Z1 hieß das technische Ungetüm, groß wie ein Tisch für acht Personen, der "Prozessor" eine metallische Apparatur. Zuses Schaltglieder funktionierten noch mechanisch, wenn sie denn funktionierten: Z1 litt an einer technischen Kinderkrankheit und verhakte sich ständig. Der Strom sollte erst ein paar Jahre später Einzug in die Computerwissenschaft halten.
[h=2]Back to the roots[/h]Die Schaltglieder, die Michael Hartmann im Sinn hat, sind ebenfalls mechanischer Natur, freilich ein wenig kleiner als die metallischen Relais von Pionier Zuse. 300 mal einen Nanometer betragen die Abmessungen jener Kohlenstoffröhrchen, über die Hartmann nun mit seinem Kollegen Simon Rips berichtet. Wie die beiden im Fachblatt "Physical Review Letters" schreiben, könnten die "nano tubes" dereinst als Rechenelemente eingesetzt werden - so wie die Bewegung von Elektronen (Strom/kein Strom) in PCs klassischer Bauart.
Die Informationseinheiten wären allerdings keine Bits, sondern Quantenbits. Nicht nur Null oder Eins, sondern auch sämtliche möglichen Überlagerungen dazwischen. Das ist die Eigenschaft, die Physiker am Quantencomputer fasziniert: Durch die notorische Unschärfe der Zustände ließen sich extrem aufwändige Rechnungen durchführen, an denen selbst Supercomputer scheitern.
Hartmanns Grundidee: Man nehme ein Nanoröhrchen, befestige es an seinen Enden auf einem Chip und rege es mittels Lichtteilchen wie eine Gitarrensaite zum Schwingen an.
Im Unterschied zur Gitarrensaite würde das Nanoröhrchen aber - tiefe Temperaturen vorausgesetzt - nach Quantenart schwingen, die Saite wäre quasi an mehreren Orten gleichzeitig. "So ähnlich, wie man auch von einem Elektron im Atom nicht sagen kann, wo es sich genau befindet", sagt Hartmann im Gespräch mit science.ORF.at. "Wir können lediglich Wahrscheinlichkeiten angeben, das Elektron an einem bestimmten Ort via Messung zu finden."
[h=2]"Fünf Jahre bis zum Nachweis"[/h]Hartmanns Nanoröhrchen-Prozessor existiert zwar bisher nur in der Theorie. Messungen von Gary Steel, Physiker an der Universität Delft, zeigen: Die Quantenschwingungen der Röhrchen bleiben eine Sekunde aufrecht. Das ist bereits genug, um sogenannte Gatter herstellen zu können. Die materielle Grundlage für quantenlogische Operationen wäre damit vorhanden - wer Gatter bauen kann, kann à la longue auch Berechnungen anstellen. Und bei der einen Sekunde werde es nicht bleiben, prognostiziert Hartmann: "Das ist mit Sicherheit noch nicht ausgereizt."
Wann wird es simple Prototypen des mechanischen Quantencomputers geben? "Der Machbarkeitsnachweis im Labor könnte in fünf Jahren gelingen", sagt Hartmann. Wie lange es dauern werde, bis man Rechnungen anstellen könne, sei schon schwieriger zu prognostizieren. "Mindestens fünf bis zehn weitere Jahre."
Wie lange es von der Idee zur Verwirklichung dauert, zeigen Quantencomputer anderer Bauart, und zwar solche, die Ionen als Rechenelemente verwenden. Das theoretische Konzept dafür (entwickelt vom Österreicher Peter Zoller und dem Spanier Ignacio Cirak) stammt aus dem Jahr 1996. Experimentell funktioniert das Ganze klaglos, den Weltrekord hält Rainer Blatt vom Institut für Quantenoptik und -Information (IQOQI) in Innsbruck mit 14 Quantenbits.
Inoffiziell sind Blatt und Co. bereits bei mehr als 20 präparierten Ionen angekommen. Simple Berechnungen sind damit schon möglich. Um wirklich aufwändige Rechnungen anstellen zu können, bedarf es allerdings viel mehr: 1.000 bis 100.000 Quantenbits ist jener Bereich, wo es richtig interessant wird.
Robert Czepel, science.ORF.at
Der letzte Schrei: Mechanischer Computer - science.ORF.at
Cu
Verbogener