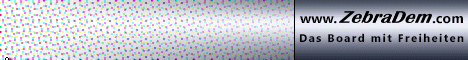Politiker, Datenschützer und Bürgerrechtler schauen einmal mehr voller Spannung nach Karlsruhe: Am 2. März will das Bundesverfassungsgericht sein Grundsatzurteil zur Datenspeicherung verkünden – zum letzten Mal mit dem scheidenden Präsidenten Hans-Jürgen Papier. Es ist davon auszugehen, dass es an deutlichen Worten nicht mangeln wird. Zum Thema Freiheitsrechte hat der Erste Senat unter dem Vorsitz Papiers bereits manches Signal gesetzt – auch im Vorfeld des nun anstehenden Urteils. In Eilentscheidungen billigten die Richter die Massen-Speicherung von Telefon- und Internetdaten zwar vorerst, schränkten deren Nutzung zur Strafverfolgung aber deutlich ein.
Im bisher umfangreichsten Massenklageverfahren in der Geschichte des Gerichts will Karlsruhe nun grundsätzlich über die Zulässigkeit der seit 2008 geltenden Speicherpflicht entscheiden. Fast 35.000 Bürger haben gegen das Vorgehen Beschwerde eingelegt, über gut 60 Verfahren wurde in Karlsruhe exemplarisch verhandelt.
Bei der Anhörung im vergangenen Dezember hatten die Richter Zweifel an der weitreichenden Nutzbarkeit der Verbindungsdaten erkennen lassen. Es sei fraglich, ob der Bundesgesetzgeber nicht klarere Grenzen für den Abruf der Daten zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung hätte ziehen müssen, sagte Präsident Papier damals. Spannend ist nun, ob das Gericht wie bei der Online-Durchsuchung oder dem großen Lauschangriff lediglich deutliche Grenzen setzt – oder ob es diesmal weiter geht.
Das Potenzial der Vorratsdatenspeicherung ist gewaltig: Die Kläger befürchten einen „Dammbruch“ bei der Einschränkung von Grundrechten. Die Sicherheitsbehörden sehen in dem Gesetz vor allem ein effektives Ermittlungsinstrument und betonen die Notwendigkeit der Speicherung für die Aufklärung von Straftaten.
In dem Verfahren gibt es drei Klägergruppen. Eine von ihnen vertritt der FDP-Politiker Burkhard Hirsch, der Kläger und zugleich Anwalt der Gruppe ist. Der Berliner Rechtsanwalt Meinhard Starostik vertritt rund 34.900 Kläger. Der Grünen-Politiker Volker Beck hat mit mehr als 40 Abgeordneten seiner Partei Beschwerde eingelegt. Auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) gehört zu den Beschwerdeführern. Die amtierende Bundesjustizministerin war aber wegen ihres „Rollenkonflikts“ nicht selbst zu der Anhörung gekommen.
Nach dem seit 2008 geltenden Gesetz, das eine EU-Richtlinie umsetzt, werden Verbindungsdaten aus der Telefon-, Mail- und Internetnutzung sowie Handy-Standortdaten für sechs Monate gespeichert. Gesprächs- und Mail-Inhalte sind nicht betroffen. Abrufbar sind sie für Zwecke der Strafverfolgung sowie der Gefahrenabwehr. Das Gericht hat die Anwendbarkeit des Gesetzes 2008 vorerst eingeschränkt. Laut einstweiliger Anordnungen dürfen die Daten bis auf weiteres nur für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten genutzt werden.
Nach einem „Spiegel“-Bericht hat die neue EU-Justizkommissarin Viviane Reding eine grundlegende Überprüfung der entsprechenden EU-Richtlinie angekündigt. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission wolle sich für das richtige Gleichgewicht zwischen der Terrorismusbekämpfung und der Achtung der Privatsphäre einsetzen und die Richtlinie noch in diesem Jahr auf den Prüfstand stellen. Reding sieht demnach die bislang geltende Vorgabe kritisch, nach der die Kommunikations-Verbindungsdaten aller Bürger ohne jeden Verdacht von den Anbietern für mindestens sechs Monate gespeichert werden müssen.
Q: infosat.de