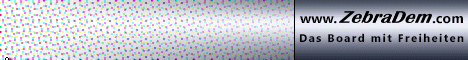[color="Yellow"]Regelmäßiger eBay-Verkauf privater Ware gilt als gewerblich![/color]
eBay-Nutzer, die regelmäßig über die Internet-Handelsplattform Waren verkaufen, ist auch dann gewerblich tätig, wenn die Gegenstände aus seinem Privatvermögen stammen. Das berichtet die Zeitschrift „OLG-Report“ unter Berufung auf einen kürzlich gefällten Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt.
Dem Richterspruch zufolge sei maßgeblich, dass eine „auf Dauer angelegte wirtschaftliche Betätigung“ vorliegt (Az.: 6 W 27/07). Damit entschied das Gericht, dass sich ein privater Verkäufer bei seinen Geschäften über eBay an die Regeln des für Profis geltenden Wettbewerbsrechts halten muss.
Mit der Begründung, er verkaufe lediglich Waren aus seinem Privatvermögen und betreibe daher keinen professionellen Handel, hatte der Betroffene die Vorwürfe abgelehnt. Um einen professionellen Handel zu betreiben, sei seiner Meinung nach neben dem Verkauf von Waren auch der Ankauf notwendig.
Das Oberlandesgericht folgte dieser Auffassung nicht. Maßgeblich sei allein, dass der Verkäufer schon über ein Jahr kontinuierlich Waren verkaufe. Aus rein rechtlicher Sicht betrachtet, werde er damit vom Verbraucher zum Gewerbetreibenden. Aus diesem Grund müsse er bei seinen Geschäften die Regeln des Wettbewerbsrechts sowie die nach dem Zivilrecht für Unternehmer geltenden Belehrungs- und Informationspflichten beachten.
Im vorliegenden Fall hatte der Beschuldigte binnen eines Jahres bei eBay 484 bewertete Geschäfte getätigt. Nach eigenen Angaben stellte der Antragsgegner pro Woche etwa 20 bis 30 Stempel in seinem eigenen Shop bei der Internet-Handelsplattform ein. Laut OLG belege der Umfang und die Ausgestaltung der Verkaufstätigkeit eindeutig eine gewerbliche Tätigkeit. Nach Angaben des Beschuldigten wollte er eine über 100 000 postgeschichtliche Belege umfassende Stempelsammlung Stück für Stück verkaufen. (computer-partner)
[color="Yellow"]Das Fragerecht des Arbeitgebers nach Schwerbehinderungen von Bewerbern[/color]
Arbeitgeber dürfen Bewerber um eine Arbeitsstelle im Rahmen des Einstellungsgesprächs nur sehr eingeschränkt nach einer möglichen Schwerbehinderung befragen. Arbeitnehmer sind lediglich verpflichtet, darüber Auskunft zu geben, ob sie unter körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen leiden, durch die sie für die vorgesehene Tätigkeit ungeeignet sind. Ein generelles Fragerecht nach einer bestehenden Schwerbehinderung besteht dagegen nicht. Diese Rechtslage hat das Landesarbeitsgericht Hamm am 19. Oktober 2006 in einer neuen Entscheidung zu dieser sehr praxisrelevanten Problematik bestätigt.
In dem vorliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer geklagt, der durch einen Schlaganfall zu 60 Prozent schwerbehindert war. Der Kläger wurde als Industriereiniger und Staplerfahrer in dem beklagten Unternehmen eingesetzt.
Als der schwerbehinderte Mitarbeiter in zwei Fällen die vom Arbeitgeber angeordnete Mehrarbeit ablehnte, erhielt er zwei Abmahnungen. Hiergegen setzte er sich vor dem Arbeitsgericht zur Wehr. Im Rahmen des Klageverfahrens verwies er auf seine Schwerbehinderung und auf Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. Als der Kläger kurz darauf auch noch erkrankte, focht sein Arbeitgeber den Arbeitsvertrag gem. § 123 BGB wegen einer arglistigen Täuschung an. Der Arbeitgeber begründete dies damit, dass ihm die Behinderung des Klägers bis zur Abmahnung nicht bekannt gewesen sei.
Das Gericht gab jedoch dem Kläger und nicht seinem Arbeitgeber Recht. Es wies in seinem Urteil darauf hin, dass schwerbehinderte Mitarbeiter nicht benachteiligt werden dürfen.
Der beklagte Arbeitgeber habe nach Ansicht des Gerichts sogar noch selber angegeben, dass er den Kläger bei wahrheitsgemäßer Beantwortung der Frage nach einer Behinderung gar nicht erst eingestellt, also benachteiligt hätte. Außerdem habe der Arbeitgeber in dem konkreten Fall nicht nachweisen können, dass dem Kläger eine entscheidende Funktion oder Fähigkeit fehle, um seine Arbeit sachgerecht ausüben zu können. Die Schwerbehinderung führte jedenfalls nicht dazu, dass der Kläger für die vorgesehene Tätigkeit als Industriereiniger und Staplerfahrer generell ungeeignet war. Daher hätte der Kläger in dem Bewerbungsgespräch vor seiner Einstellung auch nicht generell nach dem Bestehen einer Schwerbehinderung befragt werden dürfen (LAG Hamm, Urteil vom 19.10.2006, Az.: 15 Sa 740/06).
Der Autor: Dr. Christian Salzbrunn arbeitet als Rechtsanwalt in Düsseldorf. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen das Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht sowie die Themen Insolvenz und Inkasso. Kontakt und weitere Informationen: Telefon +49 (0)2 11. 1 75 20 89-0, Telefax +49 (0)2 11. 1 75 20 89-9, E-Mail: [email protected], Internet: http://www.ra-salzbrunn.de (mf)
(computer-partner)
[color="Yellow"]Krankheitsbedigte Kündigung: Betriebliches Eingliederungsmanagement ist Pflicht[/color]
Ist ein Beschäftigter innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, hat der Arbeitgeber nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX unter Beteiligung des betroffenen Arbeitnehmers und der Interessenvertretung zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Kündigt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer aus krankheitsbedingten Gründen, ohne zuvor dieses betriebliche Eingliederungsmanagement durchgeführt zu haben, so führt dies nicht ohne Weiteres zur Unwirksamkeit der Kündigung.
Die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2 SGB IX ist keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine personenbedingte Kündigung aus krankheitsbedingten Gründen. Die gesetzliche Regelung ist aber auch nicht nur ein bloßer Programmsatz, sondern Ausprägung des das Kündigungsrecht beherrschenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Führt der Arbeitgeber kein betriebliches Eingliederungsmanagement durch, kann dies Folgen für die Darlegungs- und Beweislast im Rahmen der Prüfung der betrieblichen Auswirkungen von erheblichen Fehlzeiten haben. Der Arbeitgeber kann sich dann nicht pauschal darauf berufen, ihm seien keine alternativen, der Erkrankung angemessenen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Dies hat der Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichts in seinem Urteil entschieden.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt war der mit einem Grad der Behinderung von 30 einem Schwerbehinderten nicht gleichgestellte Kläger seit 1981 bei der Beklagten als Maschinenbediener beschäftigt. Seit März 2002 war er wegen eines Rückenleidens durchgehend arbeitsunfähig erkrankt. Nach Anhörung des Betriebsrats kündigte daraufhin die Beklagte das Arbeitsverhältnis des Klägers am 29. Oktober 2004 fristgemäß.Der Kläger hat sich mit seiner Klage gegen diese Kündigung gewandt und geltend gemacht, bei entsprechender Ausstattung seines Arbeitsplatzes sei sein Einsatz als Maschinenbediener weiterhin möglich. Die Beklagte hätte ihn durch eine Umgestaltung anderer Arbeitsplätze auch anderweitig einsetzen können. Hierzu sei sie auf Grund des betrieblichen Eingliederungsmanagements verpflichtet gewesen. Die Beklagte hält die Voraussetzungen für eine krankheitsbedingte Kündigung für gegeben. Sie hat die Auffassung vertreten, die Arbeitsfähigkeit des Klägers könne auf unabsehbare Zeit nicht wieder hergestellt werden. Auch eine Beschäftigung auf einem leidensgerechten Arbeitsplatz sei nicht mehr in Betracht gekommen.
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht hat den Rechtsstreit zur weiteren Sachaufklärung, insbesondere zur Klärung, ob ein leidensgerechter Arbeitsplatz vorhanden ist bzw. durch eine zumutbare Umgestaltung der Betriebsabläufe geschaffen werden könnte, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Bundesarbeitsgericht, 2 AZR 716/06. (mf/computer-partner)