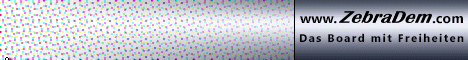Kabel-TV: Schlappe für Kabel Deutschland - EU stärkt Medienhüter
Deutsche Kabelnetzbetreiber müssen weiterhin in analogen TV-Kabelnetzen Fernsehprogramme verbreiten, die auch terrestrisch empfangen werden können. Sie müssen nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom Montag in Luxemburg hinnehmen, dass eine Landesmedienanstalt eine Reihenfolge von Sendern für die Belegung der begrenzten Kabelkanäle festlegt. Das höchste EU-Gericht entschied, "unzumutbare wirtschaftliche Folgen" dürften dadurch jedoch nicht entstehen.
Der EuGH war vom Verwaltungsgericht Hannover angerufen worden, nachdem die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH gegen die Landesmedienanstalt Niedersachsen Klage eingereicht hatte. Er sollte entscheiden, ob es mit der so genannten "Universaldienstrichtlinie" der EU vereinbar sei, wenn ein Kabelnetzbetreiber beispielsweise vom niedersächsischen Mediengesetz gezwungen werde, Programme einzuspeisen, die auch terrestrisch empfangen werden könnten. Auch fragte das Verwaltungsgericht, ob die national zuständige Behörde eine Reihenfolge von Bewerbern festlegen dürfe, die zur Vollbelegung der Kabelkanäle führe.
Keine Ausnahmeregelung für Teleshopping-Sender
Der Europäische Gerichtshof entschied (Rechtssache C-336/07), die den Kabelnetzbetreibern auferlegten Pflichten seien gerechtfertigt, weil der Staat bei der Versorgung mit Fernsehprogrammen ein Allgemeininteresse verfolge. Der Kabelnetzbetreiber könne nicht beanspruchen, die Programme selbst auszusuchen. Allerdings müsse das Verwaltungsgericht Hannover prüfen, ob "unzumutbare wirtschaftliche Folgen" drohten. Der EuGH entschied dabei, dass grundsätzlich falle auch Teleshopping-Angebote unter den Begriff der "Fernsehdienste" in der "Universaldienstrichtlinie" der EU fielen. Damit kann HSE24, QVC und Co. die Einspeisung unter Verweis auf technische Engpässe nicht verwehrt werden.